
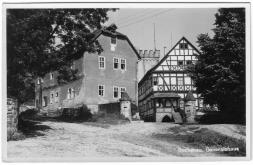
Zeittafel zur Geschichte Buchenaus und seiner Schlösser
Die Geschichte Buchenaus ist eng mit den Familien
von Buchenau und später den
Schenck zu Schweinsberg verbunden, die über Jahrhunderte hinweg die Geschicke des Ortes und seiner bedeutenden Bauwerke prägten.
Die Ära der Herren von Buchenau
-
- 1550: Das Generalshaus wird von Georg von Buchenau (1535-1563) und seiner Frau Susanne von Mansbach erbaut. Um 1555 wird die Region um Buchenau evangelisch, was einen bedeutenden religiösen Wandel darstellt.
- Ca. 1575: Das Geschlecht von Buchenau engagiert sich verstärkt im Bau von Gebäuden und finanziert dies teilweise durch Kredite vom Fürstabt in Fulda.
- 1583: Ein Vorgängerbau des späteren Schlosses existiert bereits.
- 1611-1618: Georg Melchior von Buchenau und seine Frau Agnes von Schwalbach errichten das heutige Schloss Buchenau (auch Schenckschloss genannt). Diese Bauphase fällt in den Beginn des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), der das Land schwer verwüsten wird.
- 1624-1665: Eberhard von Buchenau übernimmt das Schloss nach dem Tod seines Vaters.
- 1665-1691: Herbold Reinhard von Buchenau, verheiratet mit Anna Margarethe von Buchenau, der Tochter seines Vetters Georg, ist Besitzer des Schlosses.
- 11. März 1691: Herbold Reinhard von Buchenau verkauft das Schloss und weiteren Besitz für 10.000 Gulden an den Abt Placidius zu Fulda. Dies markiert das Ende der direkten Besitzlinie der Buchenauer am Schloss.
Fehden der Buchenauer
Die Herren von Buchenau waren im Mittelalter bekannt für ihre kriegerische Natur und waren ständig in Fehden und Aufstände verwickelt. Ihre strategische Lage zwischen den Einflussbereichen der Klöster Bad Hersfeld und Fulda nutzten sie oft zu ihrem Vorteil, was jedoch auch zu Konflikten führte.
Hier sind einige Details zu den Fehden der Buchenauer:
-
-
- Frühe Konflikte: Bereits im Jahr 1305 ist eine Sühne überliefert, die die Buchenauer für einen gescheiterten Aufstand gegen den Abt von Fulda leisten mussten. Dies zeigt, dass sie schon früh in Auseinandersetzungen mit den geistlichen Herrschern der Region verwickelt waren.
- Der hessische Bruderkrieg (1468): Das Jahr 1468 war ein Höhepunkt der Fehdeaktivitäten. Im Sommer dieses Jahres erhielten die Buchenauer allein 14 Fehdebriefe. Dies gipfelte im Herbst in einer Belagerung ihrer Burg durch eine Streitmacht von etwa 4000 Mann. Dieser Angriff fand im Rahmen des Bruderkrieges zwischen den Landgrafen Ludwig II. von Niederhessen und Heinrich III. von Oberhessen statt. Die Buchenauer hatten sich auf die Seite Ludwigs II. gestellt. Obwohl die Burg belagert wurde, konnte sie nicht eingenommen werden. Die Angreifer wurden bereits bei einem Angriff auf ein Blockhaus und durch Entsatz aus Hersfeld abgewehrt.
- Rivalitäten mit Fulda und Hersfeld: Das Verhältnis der Buchenauer zu den Fürstäbten von Fulda und Hersfeld war ambivalent. Einerseits gingen sie Geschäfte mit ihnen ein, nahmen Lehen an und verpfändeten Besitz, um Geld zu erhalten. Andererseits nutzten sie ihre Grenzlage zwischen den rivalisierenden Stiften aus und wechselten opportun die Seiten. Es gab sogar Äbte in Hersfeld (Simon von Buchenau, Albrecht von Buchenau) und Fulda (Hermann von Buchenau), die aus dem Geschlecht der Buchenauer stammten.
- Allgemeine Konfliktbereitschaft: Die Familie von Buchenau galt im 14. Jahrhundert nicht nur als eine der begütertsten, sondern auch als eine der mächtigsten und kriegerischsten Familien in Hessen, Thüringen und Franken. Sie scheuten keine Auseinandersetzungen zur Durchsetzung ihrer Interessen, pflegten Erbstreitigkeiten und Fehden mit Nachbarn und schreckten auch vor Raubzügen, Plünderungen und Brandschatzungen nicht zurück. Besonders die Cousins Eberhard „die alte Gans“ und Gottschalk sollen um 1400 die Region zwischen Kassel und Würzburg kräftig aufgemischt haben.
Diese ständigen Konflikte trugen einerseits zu ihrem Wohlstand bei, führten aber im 15. Jahrhundert auch zum langsamen Zerfall ihrer Herrschaft. Nach der vergeblichen Belagerung im hessischen Bruderkrieg von 1468 wurden große Teile der Herrschaft an das Abt Fulda verkauft.
Die Ära der Schenck zu Schweinsberg
- 1694: Wolf Christoph Schenck zu Schweinsberg, der 1689 bei Mainz verwundet wurde, beendet seinen Militärdienst. Er tauscht die Hälfte seines Besitzes in Burghaun gegen Buchenau mit dem Fürstabt von Fulda und zieht nach Buchenau.
- 1713: Das Generalshaus wird wiederhergestellt und renoviert.
- 1717: General-Leutnant und Gouverneur von Oberhessen, Wolf Christoph Schenck zu Schweinsberg, stirbt. Seine Ehe mit Anna Juliana von Boineburg blieb kinderlos.
- 1730: Die Neffen und Nichten Wolf Christophs treten das Erbe an. Dazu gehören Johann Carl Schenck zu Schweinsberg (der später Konkurs erleidet), Ludwig Wilhelm Schenck zu Schweinsberg, Anna Sidona Schenck zu Schweinsberg und Anna Juliane Schenck zu Schweinsberg. In diese Zeit fällt der Siebenjährige Krieg (1756-1763).
- 1802: Das Fürstbistum Fulda wird säkularisiert und bis 1806 unter die Herrschaft des Erbprinzen Wilhelm Friedrich von Oranien/Nassau gestellt, danach unter französische Verwaltung.
- 1807: Rittmeister Philipp Moritz Christoph von Schenck zu Schweinsberg übernimmt den Besitz in Buchenau. Die Zeit ist von den Napoleonischen Kriegen und Befreiungskriegen geprägt, was zu häufigen Herrschaftswechseln führt: 1810 Großherzogtum Frankfurt, 1813 unter österreichische, 1815 unter preußische und 1816 zum Kurfürstentum Hessen.
- 1840: Major a.D. Carl Wilhelm Georg Julius Friedrich von Schenck zu Schweinsberg wird Besitzer.
- 1866: Nach dem Deutschen Krieg gehört Buchenau nun zu Preußen.
- 1869: Ernst Moritz Ludwig Schenck zu Schweinsberg, königlicher Rittmeister, übernimmt das Anwesen. Der Deutsch-Französische Krieg (1871) prägt diese Zeit.
- 1887: Hans Hermann Georg Conrad Schenck zu Schweinsberg, königlicher Leutnant, wird der letzte Schenck zu Schweinsberg auf Buchenau.
- 1903: Das Schloss und das Generalshaus erfahren erneute Umbauten und Renovierungen.
- 19. Oktober 1912: Hans Schenck zu Schweinsberg stirbt, im selben Jahr, in dem die RMS Titanic untergeht. Sein Tod markiert das Ende der Ära der Schenck zu Schweinsberg in Buchenau.
Neue Nutzungen und das moderne Buchenau
- 1913: Das Schloss wird für 650.000 Mark zwangsverkauft und geht an Frhr. Herremann von Suydtwyk über.
- 1917: Während des Ersten Weltkriegs (1914-1918) wird der Zentralbau errichtet und das Schloss als Flüchtlingsheim für Vertriebene aus dem Elsass vom Elsaß-Lothringischen Hilfsbund genutzt.
- 1922: Eine Nutzung als Alters- und Waisenheim durch die „Hessische Heimat“ beginnt.
- 1924-1984: Eine Stiftung, das Deutsche Landerziehungsheim, betreibt ein Internat im Schloss. Diese Zeit umfasst den Zweiten Weltkrieg (1939-1945), nach dem Buchenau zu Hessen gehört.
- 1989-1999: Das Schloss dient als Heim für DDR-Flüchtlinge und Aussiedler aus Deutschstämmigen Gebieten, passend zur Grenzöffnung der DDR 1989.
- Seit 2000: Das Gelände wird als Seminarhaus genutzt.


Dorf Buchenau

In Buchenau / Osthessen, begegnen wir einer reichen Geschichte, die von einem einst mächtigen Adelsgeschlecht, prächtigen Renaissancebauten und einer strategisch wichtigen Lage geprägt ist.
Die Herren von Buchenau – Aufstieg und Fall
Die erste Erwähnung Buchenaus stammt aus dem Jahr 948, während das Adelsgeschlecht „von Buchenau“ erstmals 1217 dokumentiert wurde. Ihre geografische Position zwischen den Klöstern Bad Hersfeld und Fulda nutzten die Buchenauer geschickt aus, indem sie je nach politischer Lage ihre Allianzen wechselten. Diese Taktik sowie zahlreiche Fehden mit Nachbarn, die sich in 14 Fehdebriefen aus dem Jahr 1468 manifestierten, führten zu einem wachsenden Wohlstand und einer zunehmenden Familiengröße.
Die Familie residierte in der
Stammburg, dem heutigen Seckendorffschloss, und dem später errichteten
Spiegelschloss. Im Jahr
1550 ließ Georg von Buchenau mit seiner Frau Susanne von Mansbach das
Generalshaus erbauen. Mit der weiteren Vergrößerung der Familie entstand das
Schenckschloss. Nach dem
Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) änderten sich die Machtverhältnisse grundlegend, und die Bedeutung sowie der Reichtum der Familie von Buchenau nahmen ab. Das Geschlecht erlosch schließlich im Jahr
1815, als der letzte Nachkomme, Ludwig Karl von Buchenau, sich tragischerweise aus Liebeskummer das Leben nahm.
Die Schlösser von Buchenau
Der vorherrschende Baustil in Buchenau ist die
Renaissance, was der Blütezeit des Ortes vor dem Dreißigjährigen Krieg zu verdanken ist. Da die Buchenauer später nicht mehr die finanziellen Mittel hatten, ihre Gebäude dem jeweiligen Zeitgeschmack anzupassen, sind viele Renaissancebauten bis heute weitgehend unverfälscht erhalten geblieben.
- Schenckschloss (erbaut 1611–1618): Dieses Schloss, benannt nach den späteren Besitzern Schenck zu Schweinsberg, wurde von Georg Melchior von Buchenau und Agnes von Schwalbach errichtet. Für den Bau lieh man sich Geld vom Fürstabt zu Fulda. Im Jahr 1680 verkaufte die Familie Buchenau das Schloss zusammen mit einem Großteil ihrer fuldischen Lehen an den Fürstabt. Später wurde es im Tausch gegen das Schloss in Burghaun an die Familie Schenck zu Schweinsberg übergeben, die 1694 in Buchenau einzog und sowohl das Schenckschloss als auch die Obere Burg bewohnte. Die Familie bezog ihr Einkommen hauptsächlich aus dem zum Schloss gehörenden Waldbesitz und später auch aus einer Ziegelei.
- Anbauten und Schicksal: Im Jahr 1910 wurde am Schenckschloss ein weiterer Treppenaufgang, der sogenannte Hochzeitsturm, anlässlich der Hochzeit von Hans Schenck zu Schweinsberg mit seiner Frau Else angebaut. Nur zwei Jahre später, 1912, war Hans Schenck zu Schweinsberg insolvent und nahm sich das Leben. Das Schloss wechselte daraufhin mehrmals den Besitzer. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Mittelbau errichtet und Flüchtlinge aus dem Elsass im Schloss untergebracht. 1924 erwarb eine Stiftung das Schloss und betrieb dort bis 1984 ein Internat, gefolgt von einem Umsiedlerheim. Seit 2001 wird das Gelände als Gruppenhaus genutzt.
- Generalshaus: Dieses Gebäude, 1550 errichtet, erhielt 1903 einen Turmanbau als Kopie des Turmes der Wartburg.
Weitere Sehenswürdigkeiten und Ortsgeschichte
Die evangelische Kirche in Buchenau, erbaut zwischen 1568 und 1573 von Eberhard von Buchenau, ist bemerkenswert, da sie die erste rein evangelisch erbaute Kirche in Hessen war. Im Inneren befinden sich noch Grabplatten der Familie von Buchenau. Auch der alte Ortskern mit seinen verwinkelten Fachwerkhäusern ist einen Besuch wert.
Im Zuge der Gebietsreform von
1972 verlor Buchenau seine Eigenständigkeit und wurde ein Ortsteil von
Eiterfeld. Der Name Eiterfeld leitet sich übrigens vom durchfließenden Bach „Eitra“ ab, der in alten Urkunden als „Aeddiraha“ („schnell fließender Bach“) bezeichnet wurde.


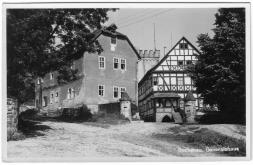


 In Buchenau / Osthessen, begegnen wir einer reichen Geschichte, die von einem einst mächtigen Adelsgeschlecht, prächtigen Renaissancebauten und einer strategisch wichtigen Lage geprägt ist.
In Buchenau / Osthessen, begegnen wir einer reichen Geschichte, die von einem einst mächtigen Adelsgeschlecht, prächtigen Renaissancebauten und einer strategisch wichtigen Lage geprägt ist.